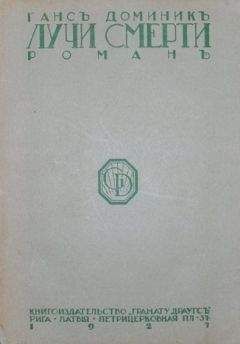(Daß es sich mit dem Blumenstrauß anders zugetragen hatte als ausgemalt und befürchtet, konnte Isa nicht wissen. Ein junger Mann war in der Dämmerung am Grünen Weg 30 vorbeigelaufen, hatte den Strauß hinter dem Gartentor liegen sehen, hatte sich unbemerkt hineingeschlichen und ihn entwendet, um ihn seiner Liebsten zu bringen, das Kärtchen natürlich abgerissen und in einen Papierkorb geworfen, wo es den üblichen Weg der Leerung, des Mülltransportes und schließlich der Verbrennung ging.)
Auf ihrer Haut überlief sie’s wirr. Er und sie lebten in einer kleinlichen Welt voller Nein. Sie würde jetzt alles auseinanderfalten, was in ihr war, Böses, Gutes, Dummes, Gescheites, Peinliches. Zeit, mit der eigenen inneren Weltauslegung zu beginnen. Peinlich, sie war peinlich. Die unwiderrufliche Wohlgelittenheit hatte sie nicht bei ihrem Gott gefunden und war dadurch peinlich geworden.
Es goß in Strömen. Sie war durchnäßt.
Scheiße! überbrüllte sie Springsteen.
Sie waren nicht zwei verzweifelte junge Leutchen, nicht Romeo und Julia aus der amerikanischen Provinz, die keinen Ausweg wußten. Peinlich, peinlich, der Gott ihrer Wahl war ein alter Mann.
Es goß in Strömen. Der Scheibenwischer arbeitete wie verrückt. Blumenberg öffnete die Wagentür.
Mit Springsteens Stimme und einem über die Schulter gehängten Täschchen wanderte Isa aus dem Zimmer, wanderte aus der Wohnung, wobei sie keine Mühe darauf verschwendete, die Tür hinter sich zuzuziehen, wanderte zu ihrem Fahrrad, das sie unverschlossen vor dem Haus abgestellt hatte, setzte sich auf den Sattel und fuhr los. Erst als sie hundert Meter oder mehr gefahren war, hörte sie Springsteens Stimme nicht mehr.
Es machte Spaß, in den leeren Straßen herumzufahren, nachmittags bei warmem Wetter. Wie dumm, daß ihr mitten in der Stadt ausgerechnet Gerhard in die Quere kommen mußte, vielleicht aber auch nicht dumm, immerhin, er hatte ein Anrecht auf ein bedeutendes Wort, das er immer behalten würde. Aber sie durfte sich nicht ablenken lassen, von ihm schon gar nicht, Gerhard war stur, der gab nicht so schnell auf, sie radelte wieder los und radelte und radelte, wobei es ein Wunder war, daß sich das lange Flatterkleid nicht in den Speichen verfing, sie kannte den Weg, den sie schon öfter mit dem Alfa gefahren war, er führte auf breiten Straßen aus der Stadt hinaus, wo der Verkehr mächtig zunahm und sie selbst, das fühlte sie deutlich, in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo, das nicht in solchen Verkehr gehörte, wahrgenommen wurde inmitten all der sonntäglichen Kaffeefahrer, die sie verblüfft überholten, nichts konnte, rein gar nichts konnte ihr geschehen, sie hätte auch gegen den Gegenverkehr anfahren können, sie war der lebendige Gegensatz zur Welt und auf der Flucht, auch Fliehen ist Handeln, und Blumenberg — Blumenberg hatte ihr diesen Gegensatz angesonnen, Blumenberg hatte ihr Bescheid gestoßen, er schob sie von hinten an mit seinem langen, ellenlangen Zeigefinger, den er ihr in den Rücken gebohrt hatte und mit dem er bis an ihr Herz vorgedrungen war, fahr, fahr, fahr voran, mein armes durchtränktes Seelchen, fahr, du schlägst noch mit den Flügeln und erhitzt dich im weißen Kleid, bräutlich gestimmt nach Art der Engel, nicht der Menschen.
Der Himmel hatte sein leichtgewichtiges Blau verloren und sich mit Blei bezogen. Isa schwitzte. Ihre Finger krampften sich um den Lenker.
Am Ziel angekommen, stieg sie umständlich vom Rad. Auf einer Brücke, unter der die Autos dicht an dicht durchfuhren, drei Spuren hin, drei Spuren her. Es kam jetzt auf jede noch so kleine Bewegung an, obwohl ihre Arme und Beine, bedeckt mit einem Schweißfilm, zittrig und krampfig vom langen Radfahren, nicht richtig gehorchten. Ein Schwarm Krächzvögel flog dem fernen Wald zu. Grober Spott lag in ihren Stimmen. Nicht sich beirren lassen. Die Bewegungen mußten verständig ausgeführt werden, ein Guru hatte zu Meditationszwecken das Heben und Senken der Beine, das Heben und Senken der Arme, Stehen und langsames Gehen befohlen, Ferse abrollen, auf den Zehenspitzen wippen, weiter so.
Sie hatte das Perlentäschchen in den Fahrradkorb gelegt. Ein Geschenk der Mutter. Es hatte eine besondere Bewandtnis mit diesem Täschchen. Ein Gefangener hatte Perle um Perle aufgestickt, eine leicht kitschige Geduldsarbeit, die sie immer im Schrank verwahrt hatte, weil es ihr unmöglich war, mit einem an einer Kette hängenden Perlentäschchen, so einem niedlichen, süßen Ding, das dauergewellte Frauen abends ins Theater oder in die Oper mitnahmen, mit so einem Ding in Münster herumzulaufen. Weil ein Gefangener, sogar ein Lebenslänglicher, es gemacht hatte, hielt sie es trotzdem in Ehren.
Mein Geschlechtstäschchen, sagte sie laut und kam darüber ins Lächeln, sogar mit rotem Innenfutter.
Was genau war denn im Geschlechtstäschchen drin? Hm? Ein lauer Wind fuhr in ihre dünnen Haare. Sie grübelte mit zusammengezogenen Brauen wie ein Kind, das Fünf und Sieben zusammenzählen muß, während die Hände das Brückengeländer umklammerten und das rechte Bein auf die andere Seite schwang: Ein Hundertmarkschein ist drin, Dummkopf, das mußt du doch wissen, in der kleinen Börse mit dem Druckknopf, der nicht richtig schließt, bißchen Kleingeld, bestimmt ein Fünfmarkstück und paar Zehner, und was ist mit dem Tempotaschentuch, hm? wozu braucht’s denn ein Tempotaschentuch? ein oder zwei Tempotaschentücher, verkrumpelt, mit Rotz drin, hm? nicht schön gefaltet, nicht sauber, ja und was haben wir denn in dem kleinwinzigen Innentäschchen? einen Lippenstift von Chanel, hellrot, der so trocken klackt, wenn man die Haube abzieht, und das Puderdöschen, ös-chen, ös-chen, wieder so ein niedliches Ding mit falschen Brillanten als eingelegte Sterne auf blauem Grund, wenn man’s öffnet, schlägt’s wie ein Schmeichler die Augen auf, das unschuldige Ding, und, ja was denn noch? noch was und noch was, werden wir hier denn nie fertig, der Augenbrauenstift, von dem immer die Kappe herunterrutscht, ein Lippenkonturstift — unten im Verkehr tauchte ein großer, langer gelber Laster auf — und nicht vergessen, ja nicht vergessen, was denn? den Personalausweis natürlich, kleiner Dummkopf, wo hast du bloß deinen Kopf, den Personalausweis hat ein ordentliches Schwabenkind immer dabei, ausgestellt in Heilbronn mit einem Bild, auf dem das Persönchen in Schwarzweiß aussieht, als wär’s bös auf die Welt, aber was, um Gotteswillen, was will jetzt der Spatz auf dem Geländer, der so lustig mit dem Kopf ruckt, der — da war das linke Bein hinübergeschwungen, waren die Hände gelöst, und sie flog auch schon, flog engelgleich –
Wenn immer behauptet wird, in den letzten Sekunden zöge das Leben in rasendem Lauf vorüber, so trifft das in dem Fall nicht zu. Isa dachte an ihren Augenbrauenstift. Nicht an Blumenberg, wie es doch zu erwarten gewesen wäre. Bestimmt hatte sich die Kappe wieder gelöst und der Stift das Innenfutter verschmiert; sie flog und dachte mit aller Gewalt an die Schmiererei, biß die Zähne zusammen, fest, daß vom oberen linken Schneidezahn ein Stück absplitterte. Eine zu vernachlässigende Größe gemessen daran, was alles splitterte und brach, als der Körper auf dem Asphalt aufschlug.
Kurzes Zwischenstück darüber, wo die Zuständigkeit des Erzählers endet
Was weiß ein Erzähler, was weiß er nicht? Ob der Erzähler wirklich wissen kann, was einem Selbstmörder zuletzt in den Sinn kommt, ist fraglich. Natürlich, welche Kleidungsstücke getragen wurden, wie die Verlassenschaft aussah, welchen Anblick die Leiche bot, wie nah- und fernstehende Menschen darauf reagierten, das alles hat der Erzähler bis ins kleinste Detail bei sich vermerkt; er braucht nur geschickt zu wählen, geschickt auszulassen, und er darf dabei nicht allzu streberhaft sein Aufzählungsmaschinchen in Gebrauch nehmen (unter einem Riesenhaufen an Kleinigkeiten wird sonst unmerklich und ohne Gefühlsverhaftung weggestorben). Gesetzt den Fall, all dies sei berücksichtigt und mit dem nötigen Schwung versehen: siehe da, vor den Augen des mitfühlenden Lesers löscht sich ein Buchstabenleben selbst aus.
So ein Selbstmörder tut’s schlüssig, auch wenn er vorher noch ein wenig gezögert, die eine oder andere Hampelei ihn aufgehalten haben sollte, was der Erzähler selbstverständlich auch weiß, weil er ihn ja tage- und wochen-, vielleicht monatelang bei der Vorbereitung des Schlamassels hat beobachten können. Aber was genau der Selbstmörder gedacht hat? Gedankenhetze, Gedankenstillstand im letzten Augenblick? Oder der totale Rückblick, inwärts in Zeitlupe, von außen gesehen als Raffung? Sekunde der Befruchtung der Eizelle? Geburtsschrei, erster Klaps auf den Po? Kehrt, was in der Kümmerlichkeit der Erinnerung nicht geborgen ist, mit Macht zurück? Über das Individualgedächtnis hinaus? Durch alle auf der Erde stattgehabten Formen hindurch bis zur Schöpfungsnanosekunde, damit alles Gewesene innerhalb einer Sekunde imaginativ vernichtet wird und das große Aufzehren alles nimmt, was je in die Existenz eingetragen wurde?
Mit welcher Überlegenheit auch immer der Erzähler vorgibt, Bescheid zu wissen, er fischt hier bloß Luft aus der Luft. Wenn er ehrlich wäre, müßte er passen. Der Fall Isa scheint zunächst klar. Wir haben es mit einer Verliebten zu tun, die sich im Irrealis verfangen hat. Eine riesige erotische Sehnsuchtswolke trägt die schmale Person mit sich herum, geschwellt von unerfüllbaren Wünschen, die bis in den Himmel hinaufsteigen; auf ihr tyrannisches Geheiß springt sie von der Brücke. So weit, so plausibel. Die Verfinsterung treibt und bläht den Menschen, überstäubt ihn mit falschem Zucker, bis kein Genuß in der Wirklichkeit mehr möglich ist. Aber krallt sich die Wirklichkeit nicht jäh an den todbereiten Menschen an, genau in dem Augenblick, in dem es zu spät ist? Wenn eine besonnene Rückkehr nicht mehr möglich ist? Und als was blitzt das Wirkliche auf und strahlt in unwahrscheinlichem Glanz? Kleinklein, als Inhalt eines Krimskramstäschchens? Oder anders, als Spatz, in dessen ruckhaftem Hupf und Köpfchenwenden Heiterkeit und Anmut geborgen sind, daß man sich eigentlich bloß an den Haaren fassen und vergnügt loskichern müßte? (Ironie des Spatzen: hätte sich Isa in die Haare gegriffen, wäre sie aus der Balance geraten, und die Schwerkraft hätte sie ebenso erledigt.)
Dem Erzähler ist jedenfalls die Idee lieb und teuer, daß der Selbstmörder im letzten Moment von der Wirklichkeit verspottet wird, die er so geschmäht und vernachlässigt hat. Wie weggeblasen, all der falsche Zauber. Kömmt dann Wahrheit mutternackt gelaufen, kehrt sich alles um. Habhaft und stark ist sie, die Lebenswahrheit. Sie lacht den Selbstmörder aus, macht ihn zu einem jämmerlichen Idioten. (Diese Theorie würde der Erzähler natürlich nicht in Anschlag bringen gegenüber Menschen, die sich selbst töten, um der Folter oder der Ausrottung zu entgehen, die sich in einer Lage befinden, in der ihnen die Physis nur noch Qualen bereitet. Auch war ihm die Szene nie lächerlich vorgekommen, in der Sokrates den Giftbecher leert. Aber Sokrates war eben Sokrates, ein in Würde getrockneter alter Mann, der realistisch vermaß, was auf ihn zukam.)
Dem Leser steht naturgemäß frei, zu denken, was er will. Im Fall Isa mag er glauben, sie sei dem Phantom Blumenberg entgegengesprungen und kein einziger Wirklichkeitsschnipsel habe sich mehr zwischeneindrängen können. Bittesehr, dem Leser darf nicht widersprochen werden.
Da hier nun der Erzähler selbst bemüht wurde, soll er gleich noch in anderer Sache vorlaut wirtschaften dürfen, um dann für immer aus dieser Geschichte zu verschwinden: Gerhard. Der uns allen liebgewordene Gerhard, dem wir gewiß ein langes Leben gönnen. Der Erzähler, wieder souveräner Herr über die Zeit und auch ein bißchen der Faktenhuber, den wir bereits kennen, greift jetzt zu einem Enterhaken und holt eine spätere Stunde heran. Um genau zu sein: Stunde, die sich ereignet hat fünfzehn Jahre, sieben Monate und vier Tage nach jenem fatalen Sonntag im Mai.
Gerhard konnte damals, 1982, natürlich nicht wissen, daß ihm als einem der wenigen Schüler Blumenbergs ein wissenschaftlicher Aufstieg beschieden sein würde, der ohne größere Aufregungen und Widerstände gemächlich verlaufen sollte. Baur machte einfach weiter wie bisher, machte sich wenig Feinde und erwarb sich, wo immer er auftrat, Respekt oder zumindest Sympathie. Gottlob ahnte er damals nicht, daß in ihm das Schicksal seiner früh verstorbenen Eltern als rasanter Taktgeber tickte, eine böse Zeituhr, durch die seine vielversprechend anlaufende Karriere ein jähes Ende fand.
Als er sich 1997, ein knappes Jahr nach dem Tod seines Lehrers — inzwischen neununddreißig Jahre alt und glanzvoll habilitiert —, an der ETH Zürich im Fachbereich Philosophie um eine Professorenstelle bewarb und dabei so mitreißend vorsang, daß er als Prachtpferd aus dem Rennen ging, knickte er direkt nach dem Vortrag, der zu weiten Teilen seinem alten Lieblingshelden Samson gegolten hatte, Vortrag, zu dem ihn die ansonsten eher reservierten Schweizer überschwenglich beglückwünschten, noch auf dem Flur der ETH ein, fiel zu Boden und starb wenige Stunden später im Universitätsspital an den Folgen eines Hirnschlags. Baur hinterließ eine Frau, eine Tochter von sechs Jahren, einen anderthalbjährigen Sohn und einen kreuzfidelen, noch nicht ganz stubenreinen Terrier, den er seinen Kindern zu Weihnachten geschenkt hatte.
Jetzt aber Schluß mit den Todesnachrichten. Nun wollen wir den Erzähler dahin zurückscheuchen, woher er gekommen.
Von seinem anstrengenden Sonntagsausflug war er wieder nach Altenberge zurückgekehrt. Der zerwühlte Sturmhimmel hatte sich beruhigt, der Regen aufgehört, aber so viel Wasser war vom Himmel gestürzt, daß die Bäume schwer von Nässe in der Dunkelheit standen, als schwarze Massen, von denen es unaufhörlich tropfte und zu deren Füßen es gluckerte. Auf dem Weg zum Haus hatten sich große Pfützen gebildet, denen schwer auszuweichen war. Er schwor sich, dies würde der letzte Ausflug solcher Art gewesen sein, zog die nassen Schuhe aus, wusch sich die Hände und schwemmte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er war nicht in Stimmung für ein Nachtmahl, er war nicht in Stimmung zu reden. Er wollte trocken werden und sich wiederfinden.
Der Beruhigung dienlich war ein sandfarbener Kaschmirpullover, den er gewöhnlich im Arbeitszimmer trug, bequem geschnitten wie ein Sporthemd mit Kragen. Er besaß mehrere davon in unterschiedlichen Farben. Als er, gewärmt von der vertrauten häuslichen Wolle, im Musikzimmer auf dem Sofa lag, kamen seine Gedanken allmählich in ruhigeres Fahrwasser.
Gottlob umhüllte ihn wieder die Nacht. In seltener Intensität spürte Blumenberg den Schutz der Nacht. Sie entdüsterte ihn und entpflichtete ihn von der Geselligkeit, ersparte ihm törichte Überraschungen und lockerte seine geistige Apparatur. Mit feinen besonnenen Fingern hatte er eine Platte aus der Hülle gezogen, sie mit einem Läppchen überwischt und auf das Gerät gelegt. Blumenberg liebte den Moment, da sich der Tonarm senkte und die Nadel sanft auf eine Rille traf. Es knackte. Rasch hatte er zum Sofa gefunden, um schon die ersten Töne im Liegen zu hören. Einer seiner Lieblinge spielte. Arturo Benedetti Michelangeli spielte Schuberts Sonate, als würde er jeden Finger für den Bruchteil einer Sekunde hochstellen, nachdem er die Taste berührt hatte — als Mahnzeichen für den Hörer, doch bitte genau in den Ton hineinzuhorchen, während er schon am Verklingen war; selbst wenn die Musik ins Murmeln geriet, in einen sumpfigen Grund, selbst wenn sie in Kaskaden auf- und abklingelte, wenn sie ihre Perlenkränze wand und ein bißchen herumtändelte, waren die einzelnen Töne noch klar herauszuhören, besonders die hellen, die der Pianist manchmal fast bis an die Schmerzgrenze hochspitzte. Blumenberg hielt die Augen geschlossen. Das Zucken in Benedetti Michelangelis Mönchsgesicht war wieder präsent, das er einmal in einer Aufzeichnung gesehen hatte, auch dessen Äußerung, jeder wirkliche Ton sei noch unendlich weit vom möglichen entfernt, und es tue weh, mit dem Mangel auskommen zu müssen. Diese Art des Spiels war nichts für romantische Schwelger, deren Herzen sich danach sehnten, im Brausesturm davongetragen zu werden; Benedetti Michelangeli spielte für Leute wie ihn, die ihre geheime Lust an der Analyse hatten, am strukturellen Geäst der Musik, an der Präzision ihrer Wiedergabe, Leute, die hinter dem dienenden Genauigkeitseifer des Musikers die feinen Gefühlsvaleurs lieber selbst herauswitterten, als Herzbefehle vom Pianisten zu empfangen und sich von ihnen überrennen zu lassen.