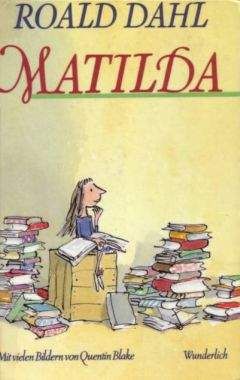Ich kann nicht hin, der Raum ist versperrt… aber ich weiß es mit allen meinen Sinnen, weiß es in jeder Sekunde… auch wenn sie hier Walzer spielen und Tango… diese Tote, ich spüre sie, und ich weiß, was sie von mir will… ich weiß es, ich habe noch eine Pflicht… ich bin noch nicht zu Ende… noch ist ihr Geheimnis nicht gerettet… sie gibt mich noch nicht frei…“
Vom Mittelschiff[278] kamen schlurfende[279] Schritte: Matrosen begannen das Deck zu scheuern[280]. Er stand auf und murmelte: „Ich gehe schon… ich gehe schon.“ Es war eine Qual, ihn anzuschauen: seinen verwüsteten [281]Blick, die gedunsenen Augen, rot von Trinken oder Tränen. Ich spürte aus seinem Wesen Scham, unendliche Scham, sich verraten zu haben an mich, an diese Nacht. Unwillkürlich sagte ich: „Darf ich vielleicht nachmittags zu Ihnen in die Kabine kommen…“
Er sah mich an – ein harter, zynischer Zug zerrte an seinen Lippen, etwas Böses stieß und verkrümmte jedes Wort.
„Aha… Ihre famose Pflicht, zu helfen… aha… Mit der Maxime haben Sie mich ja glücklich zum Schwatzen[282] gebracht. Aber nein, mein Herr, ich danke. Glauben Sie ja nicht, dass mir jetzt leichter sei. Mein verpfuschtes[283] Leben kann mir keiner mehr zusammenflicken… ich habe eben umsonst der holländischen Regierung gedient… die Pension ist futsch[284], ich komme als armer Hund nach Europa zurück… ein Hund, der hinter einem Sarg herwinselt[285]… man läuft nicht lange ungestraft Amok, am Ende schlägts einen doch nieder, und ich hoffe, ich bin bald am Ende… Nein, danke, mein Herr, für Ihren gütigen Besuch… ich habe schon in der Kabine meine Gefährten[286]… ein paar gute alte Flaschen Whisky, die trösten mich manchmal, und dann meinen Freund von damals, an den ich mich leider nicht rechtzeitig gewandt habe, meinen braven Browning… Bitte, bemühen Sie sich nicht… das einzige Menschenrecht, das einem bleibt, ist doch: zu krepieren[287] wie man will… und dabei ungeschoren zu bleiben von fremder Hilfe.“
Er sah mich noch einmal höhnisch[288]… ja herausfordernd an, aber ich spürte: es war nur Scham, grenzenlose Scham. Dann duckte er die Schultern, wandte sich um, ohne zu grüßen, und ging merkwürdig schief über das schon helle Verdeck den Kabinen zu. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Vergebens[289] suchte ich ihn nachts und die nächste Nacht an der gewohnten Stelle. Er blieb verschwunden, und ich hätte an einen Traum geglaubt oder an eine phantastische Erscheinung, wäre mir nicht inzwischen unter den Passagieren ein anderer aufgefallen, mit einem Trauerflor um den Arm, ein holländischer Großkaufmann, der eben seine Frau an einer Tropenkrankheit verloren hatte. Ich bog immer zur Seite, wenn er vorüberkam, um nicht mit einem Blick zu verraten, dass ich mehr von seinem Schicksal wusste als er selbst.
Im Hafen von Neapel ereignete sich dann jener merkwürdige Unfall, dessen Deutung ich in der Erzählung des Fremden zu finden glaube. Die meisten Passagiere waren abends von Bord gegangen, ich selbst in die Oper und dann noch in eines der hellen Cafés an der Via Roma. Als wir mit einem Ruderboot[290] zu dem Dampfer zurückkehrten, fiel mir schon auf, dass einige Boote mit Fackeln und Azetylen Lampen das Schiff suchend umkreisten, und oben am dunklen Bord war ein geheimnisvolles Gehen und Kommen von Gendarmerie. Ich fragte einen Matrosen, was geschehen sei. Er wich in einer Weise aus, die sofort zeigte, dass Auftrag zum Schweigen gegeben sei, und auch am nächsten Tage war nichts an Bord zu erfahren.
Erst in den italienischen Zeitungen las ich dann romantisch ausgeschmückt, von jenem angeblichen Unfall im Hafen von Neapel. In jener Nacht sollte der Sarg einer vornehmen Dame aus den holländischen Kolonien von Bord des Schiffes auf ein Boot gebracht werden, und man ließ ihn eben in Gegenwart [291]des Gatten die Strickleiter[292] herab, als irgendetwas Schweres vom hohen Bord niederstürzte und den Sarg mit den Trägern und dem Gatten mit sich in die Tiefe riss. Eine Zeitung behauptete, es sei ein Irrsinniger gewesen, der sich die Treppe hinab auf die Strickleiter gestürzt habe, eine andere beschönigte[293], die Leiter sei von selbst unter dem übergroßen Gewicht gerissen: jedenfalls schien die Schifffahrtsgesellschaft alles getan zu haben, um den genauen Sachverhalt zu verschleiern[294]. Man rettete nicht ohne Mühe die Träger und den Gatten der Verstorbenen mit Booten aus dem Wasser, der Bleisarg aber ging sofort in die Tiefe und konnte nicht mehr geborgen werden.
Dass gleichzeitig in einer andern Notiz kurz erwähnt wurde, es sei die Leiche eines etwa vierzigjährigen Mannes im Hafen angeschwemmt[295] worden, schien für die Öffentlichkeit in keinem Zusammenhang mit dem romantisch reportierten Unfall zu stehen; mir aber war, kaum dass ich die flüchtige Zeile gelesen, als starre plötzlich hinter dem papierenen Blatt das mondweiße Antlitz mit den glitzernden Brillengläsern mir noch einmal gespenstisch[296] entgegen.
Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten[297] durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben[298], Telegraphenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume, Koffer und Blumen wurden geschleppt, Kinder liefen neugierig treppauf und treppab, während das Orchester unerschütterlich zur Deck-show spielte.
Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten etwas abseits von diesem Getümmel [299]auf dem Promenadendeck, als neben uns zwei-oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte – anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt noch rasch von Reportern interviewt und fotografiert worden.
Mein Freund blickte hin und lächelte. „Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Czentovic.“ Und da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei: „Mirko Czentovic, der Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien.“
In der Tat erinnerte ich mich nun dieses jungen Weltmeisters und sogar einiger Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften Karriere; mein Freund, ein aufmerksamerer Zeitungsleser als ich, konnte sie mit einer ganzen Reihe von Anekdoten ergänzen. Czentovic hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst, wie Aljechin, Capablanca, Tartakower, Lasker, Bogoljubow, gestellt. Seit dem Auftreten des siebenjährigen Wunderkindes Rzecewski bei dem Schachturnier in New York hatte noch nie der Einbruch eines völlig Unbekannten in die Gilde derart[300] allgemeines Aufsehen erregt. Denn Czentovics intellektuelle Eigenschaften schienen ihm keineswegs solch eine blendende Karriere von vornherein[301] zu weissagen. Bald sickerte[302] das Geheimnis durch, dass dieser Schachmeister in seinem Privatleben außerstande[303] war, in irgendeiner Sprache einen Satz ohne orthographischen Fehler zu schreiben.
Sohn eines blutarmen südslawischen Donauschiffers, dessen winzige Barke eines Nachts von einem Getreidedampfer überrannt[304] wurde, war der damals Zwölf. Nach dem Tode seines Vaters vom Pfarrer[305] aus Mitleid aufgenommen worden, und der gute Pater bemühte sich redlich, durch häusliche Nachhilfe wettzumachen, was das maulfaule, dumpfe, Kind in der Dorfschule nicht zu erlernen vermochte.
Aber die Anstrengungen blieben vergeblich. Mirko starrte die ihm schon hundertmal erklärten Schriftzeichen immer wieder fremd an. Wenn er rechnen sollte, musste er noch mit vierzehn Jahren die Finger zu Hilfe nehmen, und ein Buch oder eine Zeitung zu lesen, bedeutete für den noch besondere Anstrengung.
Dabei konnte man Mirko keineswegs unwillig oder widerspenstig[306] nennen. Was den guten Pfarrer aber an dem querköpfigen Knaben am meisten verdross[307], war seine totale Teilnahmslosigkeit. Er tat nichts ohne besondere Aufforderung, stellte nie eine Frage, spielte nicht mit anderen Burschen und suchte von selbst keine Beschäftigung; sobald Mirko die Verrichtungen des Haushalts erledigt hatte, saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick. Während der Pfarrer Abends mit dem Gendarmerie Wachtmeister seine üblichen drei Schachpartien spielte, hockte[308] der blondsträhnige Bursche stumm daneben und starrte unter seinen schweren Lidern anscheinend schläfrig und gleichgültig auf das karierte Brett.
Eines Winterabends klingelten, während die beiden Partner in ihre tägliche Partie vertieft waren, von der Dorfstraße her die Glöckchen eines Schlittens. Ein Bauer stapfte hastig herein, seine alte Mutter läge im Sterben, und der Pfarrer möge eilen, ihr noch rechtzeitig die letzte Ölung[309] zu erteilen. Ohne zu zögern folgte ihm der Priester. Der Gendarmerie Wachtmeister, der sein Glas Bier noch nicht ausgetrunken hatte, zündete sich zum Abschied eine neue Pfeife an und bereitete sich eben vor, die schweren Schaftstiefel anzuziehen, als ihm auffiel, wie unentwegt der Blick Mirkos auf dem Schachbrett mit der angefangenen Partie haftete.
„Na, willst du sie zu Ende spielen?“ spaßte er, vollkommen überzeugt, dass der schläfrige Junge nicht einen einzigen Stein auf dem Brett richtig zu rücken verstünde. Der Knabe starrte scheu auf, nickte dann und setzte sich auf den Platz des Pfarrers. Nach vierzehn Zügen war der Gendarmerie Wachtmeister Geschlagen.
Die zweite Partie fiel nicht anders aus. „Bileams Esel[310]!“ rief erstaunt bei seiner Rückkehr der Pfarrer aus, dem weniger bibelfesten Gendarmerie Wachtmeister erklärend, schon vor zweitausend Jahren hätte sich ein ähnliches Wunder ereignet, dass ein stummes Wesen plötzlich die Sprache der Weisheit gefunden habe. Trotz der vorgerückten Stunde[311] konnte der Pfarrer sich nicht enthalten, seinen halb analphabetischen Famulus[312] zu einem Zweikampf herauszufordern. Mirko schlug auch ihn mit Leichtigkeit. Er spielte langsam, ohne ein einziges Mal die gesenkte breite Stirn vom Brette aufzuheben. Aber er spielte mit unwiderlegbarer Sicherheit.
Der Pfarrer wurde nun ernstlich neugierig, wie weit diese einseitige sonderbare Begabung einer strengeren Prüfung standhalten würde. Er nahm Mirko in seinem Schlitten in die kleine Nachbarstadt mit, wo er im Café des Hauptplatzes eine Ecke mit enragierten Schachspielern wusste. Es erregte bei der ansässigen Runde nicht geringes Staunen, als der Pfarrer den fünfzehnjährigen Burschen in seinem hohen Schaftstiefeln in das Kaffeehaus schob, wo der Junge befremdet mit sche Augen in einer Ecke stehenblieb, bis man ihn zu einem der Schachtische hinrief.
In der ersten Partie wurde Mirko geschlagen, da er die sogenannte Sizilianische Eröffnung bei dem guten Pfarrer nie gesehen hatte. In der zweiten Partie kam er schon gegen den besten Spieler auf Remis. Von der dritten und vierten an schlug er sie alle, einen nach dem andern. Nun ereignen sich in einer kleinen südslawischen Provinzstadt höchst selten aufregende Dinge; so wurde das erste Auftreten dieses bäuerlichen Champions für die versammelten Honoratioren zur Sensation. Einstimmig wurde beschlossen, der Wunderknabe müsste unbedingt noch bis zum nächsten Tage in der Stadt bleiben, damit man die anderen Mitglieder des Schachklubs zusammenrufen und vor allem den alten Grafen Simczic, einen Fanatiker des Schachspiels, auf seinem Schlosse verständigen könne. Der junge Czentovic wurde im Hotel einquartiert und sah an diesem Abend zum ersten mal ein Stefan Zweig Wasserklosett.
Mirko, unbeweglich vier Stunden vor dem Brett sitzend, besiegte einen Spieler nach dem andern; schließlich wurde eine Simultanpartie[313] vorgeschlagen. Es dauerte eine Weile, ehe man dem Unbelehrten begreiflich machen konnte, dass bei einer Simultanpartie er allein gegen die verschiedenen Spieler zu kämpfen hätte. Aber sobald Mirko diesen Usus begriffen, fand er sich rasch in die Aufgabe und gewann schließlich sieben von den acht Partien.
Nun begannen große Beratungen. Obwohl dieser neue Champion nicht zur Stadt gehörte, war doch der heimische Nationalstolz lebhaft entzündet[314]. Vielleicht konnte endlich die kleine Stadt zum ersten Mal sich die Ehre erwerben, einen berühmten Mann in die Welt zu schicken.
Ein Agent namens Koller, sonst nur Chansonetten und Sängerinnen für das Kabarett der Garnison vermittelnd, erklärte sich bereit den jungen Menschen in Wien von einem ihm bekannten ausgezeichneten kleinen Meister fachmäßig in der Schachkunst ausbilden zu lassen. Graf Simczic, dem in sechzig Jahren täglichen Schachspieles nie ein so merkwürdiger Gegner entgegengetreten war, zeichnete sofort den Betrag. Mit diesem Tage begann die erstaunliche Karriere des Schiffersohnes.
Nach einem halben Jahre beherrschte Mirko sämtliche Geheimnisse der Schachtechnik, allerdings mit einer seltsamen Einschränkung, die später in den Fachkreisen viel beobachtet wurde. Denn Czentovic brachte es nie dazu, auch nur eine einzige Schachpartie auswendig – oder wie man fachgemäß sagt: blind – zu spielen[315]. Ihm fehlte vollkommen die Fähigkeit, das Schlachtfeld in den unbegrenzten Raum der Phantasie zu stellen. Er musste immer das schwarzweiße Karree mit den vierundsechzig Feldern und zweiunddreißig Figuren handgreiflich vor sich haben. Aber diese merkwürdige Eigenheit verzögerte keineswegs Mirkos Aufstieg. Mit siebzehn Jahren hatte er schon ein Dutzend Schachpreise gewonnen, mit achtzehn sich die ungarische Meisterschaft, mit zwanzig endlich die Weltmeisterschaft erobert.
So geschah es, dass in die illustre Galerie der Schachmeister, die in ihren Reihen die verschiedensten Typen intellektueller Überlegenheit vereinigt zum ersten Mal ein völliger Outsider der geistigen Welt einbrach, ein schwerer Bauernbursche, aus dem auch nur ein einziges publizistisch brauchbares Wort herauszulocken[316] selbst den gerissensten Journalisten nie gelang. Er ersetzte bald reichlich durch Anekdoten über seine Person. Trotz seines feierlichen schwarzen Anzuges, seiner pompösen Krawatte und seiner mühsam manikürten Finger blieb er in seinen Manieren derselbe beschränkte Bauernjunge, der im Dorf die Stube des Pfarrers gefegt. Ungeschickt suchte er zum Gaudium[317] und zum Ärger seiner Fachkollegen aus seiner Begabung und seinem Ruhm mit einer kleinlichen und sogar oft ordinären Habgier[318] herauszuholen, was an Geld herauszuholen war. Er reiste von Stadt zu Stadt, immer in den billigsten Hotels wohnend, er spielte in den kläglichsten Vereinen, sofern man ihm sein Honorar bewilligte, er ließ sich abbilden auf Seifenreklamen und verkaufte sogar, ohne auf den Spott seiner Konkurrenten zu achten, die genau wussten, dass er nicht im Stande war, drei Sätze richtig zu schreiben, seinen Namen für eine „Philosophie des Schachs“, die in Wirklichkeit ein kleiner galizischer Student für den geschäftstüchtigen Verleger geschrieben. Wie allen zähen Naturen fehlte ihm jeder Sinn für das Lächerliche: seit seinem Siege im Weltturnier hielt er sich für den wichtigsten Mann der Welt.
„Aber wie sollte ein so rascher Ruhm[319] nicht einen so leeren Kopf beduseln?“ schloss mein Freund. „Ist es nicht eigentlich verflucht leicht, sich für einen großen Menschen zu halten, wenn man nicht mit der leisesten Ahnung belastet ist, dass ein Rembrandt, ein Beethoven, ein Dante, Stefan Zweig ein Napoleon je gelebt haben? Dieser Bursche weiß in seinem Gehirn nur das eine, dass er seit Monaten nicht eine einzige Schachpartie verloren hat, und da er eben nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere Werte auf unserer Erde gibt, hat er allen Grund, von sich begeistert zu sein.“